Die Notenbanken in Europa waren lange von nationalen Interessen geprägt. Vor 25 Jahren entstand mit der Europäischen Zentralbank ein überstaatliches Währungsinstitut. Eine (Zwischen-)Bilanz.
Am 1. Juni 1998 war es so weit. Die Europäische Zentralbank (EZB) wurde gegründet. Sie ist nicht einfach irgendeine Notenbank, sondern Teil eines großangelegten politischen Projekts. Zum Start vor 25 Jahren verlegten elf Länder ihre Geldpolitik von der nationalen auf die Gemeinschaftsebene – ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in die europäische Wirtschafts- und Währungsunion.
Obwohl die neue Notenbank in Frankfurt beheimatet war, wurde sie von der deutschen Öffentlichkeit zunächst eher übersehen. So beschäftigte sich das Magazin „Der Spiegel“ in der Gründungswoche in seiner Titelgeschichte mit dem historischen Thema der Inquisition. Und die „Tagesschau“ berichtete zunächst über ein Erdbeben in Afghanistan und dann über die Wahl in Montenegro. Für die meisten Normalbürger war der geplante Euro zu diesem Zeitpunkt noch sehr abstrakt.
Mit dem Einzug des frischgewählten EZB-Präsidenten Willem Frederik („Wim“) Duisenberg und seinen fünf hochrangigen Board-Mitgliedern in die 35. Etage des 40-stöckigen Eurotowers sollte sich das ändern. Gemeinsam mit rund 500 Fachleuten aus 15 Nationen übernahmen sie die Aufgabe, das neue Geld fassbar zu machen. Zunächst galt es, zum Jahreswechsel die Austauschverhältnisse der Landeswährungen gegenüber dem Euro festzuzurren. Im Januar 2002 sollte dann der Einzug der Gemeinschaftswährung auch physisch, in Scheinen und Münzen, in die Portemonnaies der Bürger folgen.
Politische Querschläge ...
Den Deutschen fiel es schwer, sich von ihrer Mark zu trennen. Dabei sollte der Euro handfeste Vorteile bringen: eine höhere Preistransparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für Investorinnen und Investoren; einen größeren Markt für Unternehmen, die Beseitigung von Wechselkursrisiken innerhalb des Binnenmarkts und eine Reduktion der Transaktionskosten. Leider standen aber bei einigen wichtigen Entscheidungen von Anfang an weniger wirtschaftliche Sachfragen im Vordergrund als politische Erwägungen.
Das hatte EZB-Präsident Duisenberg noch vor dem Beginn seiner Amtszeit zu spüren bekommen. Er war 1997 nach dem Belgier Alexandre Lamfalussy Vorstand des Europäischen Währungsinstituts (EWI) geworden, was eine Art Zwischenetappe auf dem Weg zur EZB war. Dem EWI-Rat hatten neben Duisenberg und seinem Stellvertreter die Notenbankpräsidenten von seinerzeit 15 EU-Staaten angehört, die schon damals ihre Geldpolitik aufeinander abstimmten. In diesem Gremium soll Einigkeit darüber geherrscht haben, dass Duisenberg der erste EZB-Präsident werden sollte.
Doch der französische Staatspräsident Jacques Chirac fühlte sich übergangen und forderte eine französische Lösung, zumal Frankreich im Wettstreit um den EZB-Hauptsitz den Kürzeren gezogen hatte. Das Rennen machte am Ende dennoch der Niederländer Duisenberg. Allerdings gab es einen Kompromiss. Und so kündigte Duisenberg noch vor seinem Amtsantritt an, dass er nicht die volle Amtszeit von acht Jahren als Präsident der EZB ableisten wolle.
Auch aus geldpolitischer Sicht dominierten politische Befindlichkeiten von Anfang an die Euro-Einführung. So war die Erfüllung der vier Konvergenzkriterien Preisstabilität, Wechselkursstabilität, Haushaltsdisziplin der Staaten und die Höhe der langfristigen Zinsen für Mitgliedsstaaten als Voraussetzung für den Beitritt zur Währungsunion bereits 1992 im Vertrag von Maastricht vereinbart worden. Ein ähnliches volkswirtschaftliches Niveau der Mitgliedsstaaten sollte die Belastungen für eine gemeinsame Geldpolitik möglichst gering halten.
... begründen die Konstruktionsfehler des Euros
Doch der abschließende Konvergenzbericht des EWI vom März 1998 bestätigte gefährliche Unterschiede: Bezüglich des Kriteriums der Preisstabilität konnte zwar weitgehend grünes Licht gegeben werden, da sich die Inflationsraten der Mitgliedskandidaten einander angenähert hatten. Auch die Wechselkursschwankungen verliefen in relativ ruhigen Bahnen. Doch die Haushaltsdisziplin war von Anfang an das Sorgenkind bei der Gründung der Gemeinschaftswährung. So lag das jährliche öffentliche Defizit nicht bei allen Euro-Mitgliedern wie gefordert bei weniger als drei Prozent des jeweiligen Bruttoinlandprodukts (BIP) und der Schuldenstand der öffentlichen Hand war teils sehr weit von der Maßgabe von 60 Prozent des BIPs entfernt.
So beliefen sich Italiens Staatsschulden Ende 1997 etwa auf 117 statt auf 60 Prozent des BIP. Spitzenreiter unter den elf Gründungsländern war Belgien mit einer Quote von 124 Prozent. Mit deutlichem Abstand und einer Staatsschuldenquote von 66 Prozent folgten die Niederlande auf Rang drei. Insgesamt erfüllten nur vier der elf Länder zu diesem Zeitpunkt die Vorgabe. Dabei wies die Haushaltslage der beiden damals besonders hoch verschuldeten Staaten Mitte der 1990er-Jahre einen positiven Trend auf. So hatte Italien sein Haushaltsdefizit von 10,1 Prozent im Jahr 1992 auf knapp 3,0 Prozent im Jahr 1997 und Belgien von 8,4 auf 2,2 Prozent senken können. Dennoch reichten die erzielten Fortschritte nicht, um beide Kriterien zu erfüllen.
Erstaunlicherweise schien das am Kapitalmarkt kaum jemanden zu interessieren. Das vierte Konvergenzkriterium, eine Angleichung der langfristigen Zinsen, konnte trotz divergierender Schuldenquoten problemlos erfüllt werden. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen der Euroländer bewegten sich bereits Ende 1997 auf einem nahezu identischen Niveau (vgl. Grafik 1), da offenbar viele Investoren auf die Konvergenz der künftigen Eurostaaten spekulierten.

Auf die Entscheidung, mit diesen elf Ländern das Projekt „Euro“ zu starten, hatten die teilweise zu hohen Schuldenquoten jedenfalls keinen Einfluss mehr. Es wurde beschlossen, dass die dritte Stufe der Währungsunion erreicht sei und die EZB gegründet werden konnte. Damit wurde aber auch die Konstruktionsschwäche der Eurozone zementiert und der Grundstein für eine (inoffizielle) Haftungsgemeinschaft gelegt. Zeitgerecht zum 1.1.1999 wurden die Umrechnungskurse der elf Währungen der Mitgliedsländer zum Euro festgelegt. Währungsschwankungen innerhalb des Binnenmarkts gehörten damit der Vergangenheit an. Nun galten der Stabilitäts- und Wachstumspakt und eine gemeinsame Geldpolitik.
Fest wie Schlagsahne
Die Euro-Währungshüter sollten sich bei ihrer Politik ursprünglich vor allem an der Deutschen Bundesbank orientieren, die als besonders stabilitätsorientiert galt. EU-Präsident Jacques Delors zeigte ihre Bedeutung 1992 mit dem Satz: „Nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Bundesbank.“ Und auch Duisenberg hatte im Juli 1996 anerkennend mit einem für ihn typischen Augenzwinkern bemerkt: „Mit der Bundesbank ist es wie mit Schlagsahne – je mehr man sie schlägt, desto fester wird sie.“
Und so wurde auch die EZB mit einem klaren, auf Preisstabilität und Unabhängigkeit ausgerichtetem Mandat ausgestattet. Die Unabhängigkeit der EZB stützt sich dabei auf fünf Säulen: die finanzielle, institutionelle, operationelle, persönliche und rechtliche Unabhängigkeit. So garantiert die institutionelle Unabhängigkeit, dass Regierungen der Mitgliedsstaaten keinen Einfluss auf die Beschlussorgane der EZB ausüben dürfen. Die rechtliche Unabhängigkeit gewährleistet, dass die EZB sich bei Bedarf an den Europäischen Gerichtshof wenden kann, um ihre Unabhängigkeit durchzusetzen. Der institutionelle Rahmen für die einheitliche Geldpolitik schützt die EZB somit gegen jegliche Arten von politischer Einflussnahme – bis heute.
Und im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union wurde das Primat der Preisstabilität festgehalten: „Das vorrangige Ziel [...] ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten.“ Der Eindruck, dass es sich hierbei um ein eindeutiges Mandat handelt, trügt allerdings. Denn unklar ist, was „Preisstabilität“ überhaupt bedeutet. Der EZB-Rat definiert Preisstabilität daher zunächst im Oktober 1998 als einen „Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für das Euro-Währungsgebiet von unter zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr“.
Dieses Ziel gelte es, mittelfristig zu gewährleisten. Tatsächlich konnte sich diese Inflationserwartung in vielen Ländern zunächst verankern. Im Mai 2003 bestätigte der EZB-Rat diese Definition zwar grundsätzlich, stellte jedoch klar, die Inflationsraten mittelfristig unter, aber nahe zwei Prozent halten zu wollen. Damit setzten die Währungshüter dem Inflationsziel eine eindeutige Obergrenze, die mittelfristig mit dem Ziel der Preisstabilität vereinbar war. Mit der Anhebung der Untergrenze auf „unter, aber nahe zwei Prozent“ wollte der EZB-Rat zudem eine Sicherheitsmarge zur Vermeidung von Deflationsrisiken einbauen. Möglichen Messfehlern im HVPI und strukturell bedingten Inflationsunterschieden im Euroraum sollte so ebenfalls Rechnung getragen werden.
Fünf Jahre blieb Duisenberg EZB-Präsident. Der Beitritt Griechenlands zur Währungsunion fiel damit ebenso unter seine Ägide wie die Einführung des Euros als Bargeld im Januar 2002. Die ausgegebenen Euro-Scheine wurden damals genau beäugt – und trugen seine Unterschrift. Ab 2003 unterzeichnete dann – für volle acht Jahre – der Franzose Jean-Claude Trichet als neuer Präsident der EZB.
Erste Erfolge
Trichet war vom Referenten im französischen Wirtschafts- und Finanzministerium zum Leiter des Schatzamtes und Vorsitzenden des Pariser Clubs aufgestiegen. Er war Berater der französischen Staatspräsidenten François Mitterrand und Jacques Chirac gewesen, bevor er 1993 an die Spitze der französischen Notenbank wechselte. Er hatte den Vertrag von Maastricht mit ausgehandelt und sich als Gouverneur der Notenbank den Spitznamen „Ajatollah des starken Franc“ zugezogen, da er sich stets bereit zeigte, für die Unabhängigkeit einer Zentralbank zu kämpfen. Doch diese Überzeugung wurde in seiner Amtsperiode als EZB-Präsident hart auf die Probe gestellt.
Dabei schien sich der Euro zunächst als stabile Gemeinschaftswährung zu etablieren. Hatte der Außenwert des Euros nach dessen Einführung als Buchgeld unter Duisenberg zunächst etwa zwei Jahre lang gegenüber dem US-Dollar an Wert eingebüßt, ging es nach der Bargeldeinführung bis zum Sommer 2008 vor allem nach oben. Und das kam nicht von ungefähr: Als die Inflation ab 2005 knapp oberhalb der Zwei-Prozent-Marke lag, reagierten die Währungshüter entschlossen. Sie erhöhten den Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte von zwei Prozent anno 2005 auf vier Prozent im Jahr 2007. Zum Vergleich: Zuletzt brauchte es für eine Anhebung auf ein gleich hohes Zinsniveau eine Inflationsrate von 8,4 Prozent (vgl. Grafik 2). Serviert also die EZB unter der amtierenden Präsidentin Christine Lagarde nur noch Wackelpudding statt der Schlagsahne, die Duisenberg angestrebt hatte?
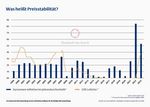
Die Bewährungsprobe begann für Trichet mit dem Beginn der Finanzkrise ab Sommer 2008, als die EZB die Zinsen auf ein Prozent senkte. Doch das reichte nicht.
Tabubruch in der Eurokrise
Ab 2009 begann auch noch die Eurokrise, und es zeigte sich, dass sich die (Preis-)Stabilitätskultur einer Bundesbank nicht einfach auf die EZB übertragen ließ. In der Eurozone mussten immer mehr Staaten eingestehen, jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt zu haben. Mit der 2010 eingerichteten Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und dem 2011 als deren Nachfolger verabschiedeten Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) wurde ein – politisch umstrittener – Rettungsschirm aufgespannt. Als erstes Land schlüpfte 2010 Irland darunter; es folgten Portugal, Griechenland, Spanien und Zypern.
Unter Trichets Ägide brach die EZB dann mit einem Tabu: Sie kaufte Anleihen von klammen Eurostaaten wie Griechenland, um diesen Ländern unter die Arme zu greifen. Nicht alle im EZB-Rat hatten dafür gestimmt und Trichet geriet rasch unter Beschuss: „Ich weiß, dass einige dieser Entscheidungen nicht unbedingt von allen gutgeheißen wurden“, sagte Trichet später. „Aber ich bin überzeugt, dass sie notwendig waren – insbesondere in Europa.“
So drohte in Griechenland eine Staatspleite. Aber auch Spaniens Staatsschuldenquote war von 36 Prozent des BIP Ende 2007 auf 101 Prozent per 2013 gestiegen. Irlands Staatsverschuldung hatte sich sogar von 24 auf 120 Prozent des BIP verfünffacht. Die Eurozone drohte an einer Staatsschuldenkrise zu zerbrechen. Sechs der zwölf Eurostaaten, die im Jahr 2002 gemeinsam das Euro-Bargeld eingeführt hatten, erreichten nach der Finanzkrise eine Staatsschuldenquote von mehr als 100 Prozent des BIP.
Und lediglich die rund 543.000 Luxemburger konnten zu diesem Zeitpunkt auf eine Staatsschuldenquote blicken, die unter der Maastricht-Grenze von 60 Prozent des BIP lag. Der Anfangsverdacht einer (zu) heterogenen Währungsgemeinschaft schien sich zu bestätigen. Die Konvergenz bei den Renditen der Staatsanleihen war trügerisch gewesen (vgl. Grafik 3).

Trichet hatte im Mai 2010 gezeigt, dass die EZB-Notenbanker im Notfall bereit waren, Grenzen ihres Mandats zu überschreiten: Er hatte das Securities Markets Programme (SMP) initiiert, das Staatsanleihenkäufe als geldpolitisches Werkzeug enttabuisierte. Bis 2012 erwarb die EZB für mehr als 200 Milliarden Euro Staatsanleihen Griechenlands, Irlands, Italiens, Portugals und Spaniens. Seinerzeit argumentierte die Notenbank, dass eine Störung an den Kapitalmärkten vorläge und der geldpolitische Transmissionsmechanismus wiederhergestellt werden müsse.
Dabei war diese Einschätzung schon damals nicht unbedingt überzeugend. So waren die Zinsen für Wohnungsbau- und Unternehmenskredite zum Zeitpunkt der Programmauflage im Vergleich zu den Vorjahren, in denen kein SMP aufgelegt worden war, relativ niedrig.
Die Kreditversorgung der Realwirtschaft wirkte also keineswegs zu restriktiv, der geldpolitische Transmissionsmechanismus schien durchaus intakt. Ging es also schon damals vor allem darum, hochverschuldeten Mitgliedsstaaten geldpolitischen Geleitschutz zu gewähren? (vgl. Grafik 4 auf Seite 28)

Im November 2011 – und damit mitten in der Eurokrise übergab Trichet dann das Ruder an den neuen EZB-Präsidenten Mario Draghi. Nach einer Karriere als akademischer Ökonom in Italien hatte er zunächst für die Weltbank in Washington gearbeitet. 1991 war er Generaldirektor des italienischen Finanzministeriums geworden und wechselte von dort nach einem Jahrzehnt zur Investmentbank Goldman Sachs, bis er 2006 zum Gouverneur der Banca d’Italia berufen wurde.
Mit "Super-Mario" zur Allmacht der Notenbank
Als EZB-Präsident fing sich Mario Draghi in den Boulevardmedien rasch den Spitznamen „Super-Mario“ ein, weil er bereits im Juli 2012 schaffte, was Hilfsprogramme und Abkommen zuvor nicht vermocht hatten. Er beruhigte die Finanzmärkte mit den magischen Worten: „Die EZB wird alles tun, um den Euro zu stützen – und Sie können sicher sein, dass es genug sein wird.“
Doch der Italiener brach auch endgültig mit dem Erbe der Bundesbank. Er sah sich nicht einer strikten Stabilitätspolitik verpflichtet, sondern warnte immer wieder eindringlich vor Deflationsrisiken. Unter seiner Ägide blieben die Zinsen auch in Wachstumsjahren auf niedrigstem Niveau. Und der Tabubruch wurde zur neuen Normalität. Denn Draghi scheute sich nicht, unorthodoxe Instrumente im großen Stil einzusetzen und die Finanzmärkte mit immer mehr Geld zu fluten.
Und so sollte der geldpolitische Handlungsspielraum der EZB nach der Eurokrise immer weiterwachsen. Zentral war in diesem Zusammenhang die Neudefinition des Preisstabilitätsziels, angestoßen von Mario Draghi im Juni 2016. Er argumentierte für ein symmetrisches Inflationsziel, das fortan in die Entscheidungsfindung des EZB-Rats einfließen sollte und im Juli 2021 – unter seiner Nachfolgerin Christine Lagarde – offiziell als symmetrisches Zwei-Prozent-Inflationsziel vollendet wurde. Wobei „symmetrisch“ bedeutet, dass zwei Prozent Inflation keine Höchstgrenze mehr darstellte, sondern Abweichungen nach oben und unten zum Handeln verpflichteten; auch wenn sie eine Zeit lang toleriert werden durften, solange sich die Inflationserwartungen nicht verschoben. Aber auch zu wenig Inflation oder eine sehr hohe Geldwertstabilität wurde nun zu einem Problem deklariert.
Auf dieser Grundlange rechtfertigten die Euro-Währungshüter Ende 2017 dann neue, umfangreiche Wertpapierkäufe, da die Eurozonen-Inflation in 2017 bei 1,5 Prozent lag und die EZB-Projektionen für die Jahre 2018 und 2019 auch nur 1,4 beziehungswiese 1,5 Prozent Inflation erwarten ließen. Mit einem Tempo von 30 Milliarden Euro pro Monat wurden die Wertpapierkäufe fortgesetzt, obwohl sich die Summe der anno 2015 initiierten Wertpapierkäufe bereits auf mehr als zwei Billionen Euro belief.
Auch die Kompetenzen schwollen unter seiner Ägide an. So übernahm die EZB in den Jahren 2013 und 2014 sukzessive die Bankenaufsicht im Währungsgebiet. Zwar gab es gute Gründe für eine Zentralisierung der Aufsicht. Beispielswiese den Umstand, dass viele europäische Banken über wechselseitige Geschäftsbeziehungen stark miteinander verknüpft sind. Warum die zentrale Aufsichtsinstanz nun aber bei der EZB angesiedelt wurde, wirft bis heute Fragen auf.
Denn interne Interessenkonflikte mit der Geldpolitik sind programmiert. Leitzinsanhebungen, wie wir sie jüngst gesehen haben, führen etwa zu Kursabschlägen bei Anleihen. In der Folge können Banken zu Abschreibungen auf ihre Wertpapierbestände gezwungen sein. Nimmt die EZB in ihren geldpolitischen Entscheidungen aber Rücksicht auf die Nöte der Banken, kann dies zu einem Vertrauensverlust führen. Denn ihr vorrangiges Ziel sollte die Preisstabilität sein. Daneben kann es zu einer Gefährdung der externen geldpolitischen Unabhängigkeit kommen, wenn beispielsweise Politiker versuchen, in Krisenfällen Einfluss auf weitreichende Entscheidungen der Bankenaufsicht zu nehmen.
Mitten in Draghis Amtszeit, im November 2014, zog die EZB vom Eurotower in ihr neues, vom Wiener Architektenbüro Coop Himmelb(l)au entworfenes Gebäude im Frankfurter Ostend. Der Bau war über viele Jahre geplant worden und die alten Büros platzten aus den Nähten. Aus ursprünglich 500 Mitarbeitern waren mehr als 2.500 geworden – und das personelle Wachstum sollte weitergehen.
Eine Juristin an der Spitze
Im November 2019 folgte dann Christine Lagarde für viele überraschend auf Draghi. Lagarde ist nicht nur die erste Frau an der Spitze der Notenbank. Sie war als einzige auch keine Notenbankerin, sondern eine studierte Juristin, die über viele Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet hatte, bevor sie 2005 zunächst französische Handelsministerin und dann 2007 Wirtschafts- und Finanzministerin wurde. Danach hatte sie für einige Jahre die Leitung des Internationalen Währungsfonds (IWF) übernommen.
Lagarde wurde schon ab März 2020 mit den Folgen der Corona-Pandemie konfrontiert. Und sie setzte nicht nur Draghis Nullzinspolitik fort, sondern nutzte auch das Instrument der Wertpapierkäufe intensiv: Nachdem die EZB per Februar 2020 bereits knapp 2,7 Billionen Euro an Wertpapieren zu geldpolitischen Zwecken hielt, stieg dieser Betrag bis Ende 2022 auf fast fünf Billionen Euro an. Gut vier Billionen Euro flossen dabei in Staatsanleihen oder Anleihen staatsnaher Emittenten.
Im Ergebnis hielt das Eurosystem Ende vergangenen Jahres 26,1 Prozent der italienischen und 28,3 Prozent der spanischen Staatsschulden. Und weil das unter Umständen immer noch nicht ausreichen könnte, intervenierte EZB-Präsidentin Lagarde im Juli vergangenen Jahres. Sie kündigte an, im Rahmen des neu geschaffenen Transmission Protection Instrument bei Bedarf unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen, sollten die Euro-Staatsanleiherenditen nach Ansicht des EZB-Rats zu weit auseinanderlaufen.
Die ursprünglich angestrebte wirtschaftliche Konvergenz ihrer mittlerweile 20 Mitgliedsstaaten kann die EZB zwar nicht erzwingen. Aber sie kann mit derartigen Maßnahmen die Schuldentragfähigkeit selbst hoch verschuldeter Mitgliedsstaaten gewährleisten. Damit hat sich die (in-)direkte Staatsfinanzierung zur Euro-Rettung nun „offiziell“ etabliert.
Auch das Thema Klima schrieb sich die neue EZB-Chefin auf ihre Agenda. Als der IWF im April 2023 zu seiner jährlichen Frühjahrstagung einlud, sagte Lagarde, dass klimabezogene Risiken und Umweltrisiken in den Jahren 2023 bis 2025 zu den Topprioritäten der EZB-Aufsicht gehören sollen. Das das konkret bedeuten soll, bleibt aber zunächst unklar.
Sollen demnächst auch Meteorologen oder Seismologen zum Mitarbeiterstamm der EZB gehören, um bilanzspezifische Hochwasser- und Erdbebenrisiken einzelner Bankinstitute besser einschätzen zu können? Oder will sie gar die Wertpapierbestände der Notenbank in „grüne“ Anlagen umschichten? Über Letzteres sollte jedenfalls kein nennenswerter Beitrag geleistet werden können, wenn es nach Bundesbankpräsident Joachim Nagel geht. Schließlich werden Tilgungszahlungen im Rahmen des rund drei Billionen Euro schweren Wertpapierkaufprogramms APP seit Juli nicht länger reinvestiert.
Geldpolitik, Fiskalpolitik, Finanzstabilitätspolitik und jetzt auch noch Klimapolitik. Die EZB möchte zum „Alleskönner“ werden. Doch das wirft Fragen auf:
- Ist die bewusste Inkaufnahme potenzieller Interessenkonflikte eine Verletzung des vorrangigen Mandats der Preisstabilität?
- Wie weitreichend dürfen Markteingriffe einer Notenbank sein?
- Liegt es im Kompetenz- und Verantwortungsbereich der Währungshüter, zig Billionen Euro an Wertpapieranlagen über viele Jahre zu verwalten oder Klimarisiken zu beurteilen?
- Wie weit darf die EZB gehen, ehe sie das Verbot der monetären Staatsfinanzierung verletzt?
Viele dieser Streitpunkte werden derzeit ignoriert beziehungsweise akzeptiert. Vielleicht, weil ohne die Notenbank und deren „Druckerpresse“ nichts mehr laufen würde? Dabei verhageln rekordhohe Inflationsraten im Euroraum der EZB nun das 25-Jahres-Jubiläum, das bislang nur sehr verhalten begangen wurde. Nicht zu Unrecht. Lange haben Lagarde und der EZB-Rat den bereits im vierten Quartal 2021 erfolgten Anstieg des Preisniveaus ignoriert beziehungsweise als vorübergehendes Phänomen eingestuft. Erst im vergangenen Sommer begann dann eine Geldstraffung in einem noch nie dagewesenen Tempo. Die Feierlaune hält sich derzeit also eher in Grenzen.
Eine für alle und alle für eine
Klare Kante ist nicht die Sache einer auch politisch denkenden Notenbank. In den vergangenen Krisen bewegte sich die EZB mehrfach im Graubereich. Die angestrebte wirtschaftliche Konvergenz der mittlerweile 20 Mitgliedsländer wurde nie wirklich erreicht. Die Eurozone ist aus wirtschaftlicher Sicht äußerst heterogen geblieben. Viele geben der jahrelangen Null- und Negativzinspolitik der EZB zudem eine wesentliche Mitschuld an den außergewöhnlichen Inflationsraten, die inzwischen zur Belastung vieler, insbesondere ärmerer Haushalte werden. Allesamt Gründe, die eine gewisse Skepsis gegenüber der EZB begründen.
Wie weit die Geschichte diese Institution noch tragen wird, vermag heute niemand zu sagen. Vielleicht aber weiter, als so mancher Kritiker vermuten würde. Vielleicht liegen gerade in den bekannten Schwachstellen der EZB ihre Stärken? Kann es nicht auch vertrauensstiftend sein, wenn Bürgerinnen und Bürger sich nicht um Staatspleiten sorgen und der Staat in Krisenzeiten als Sicherungsnetz agieren kann?
Wenn Grenzen ausgereizt werden, um eine (Währungs-)Gemeinschaft zu schützen, die mittlerweile auch als Verbund zur Wahrung unserer demokratischen und freiheitlichen Grundprinzipien verstanden werden soll? Die Beantwortung dieser Fragen ist keineswegs einfach. Es gibt gute Gründe, die für das (historische) Handeln der EZB sprechen.
Ebenso finden sich aber auch zahlreiche Argumente, die das Handeln in ein schlechteres Licht rücken. Was ist richtig, und was ist falsch? Die Welt der Währungen ist komplex. Nicht immer gibt es eindeutige und vor allem allgemeingültige Antworten.
Geldpolitik besteht eben immer auch aus Politik. In letzter Instanz entscheiden allein die knapp 350 Millionen Bürgerinnen und Bürger des Euroraums, ob sie unserem Finanz- und Währungssystem weiter ihr Vertrauen schenken. Ist das der Fall, so ist die Silberhochzeit erst der Anfang dieser Institution für viele weitere gemeinsame Jahre und Jahrzehnte. Es liegt also auch an uns selbst, ob der Euro eine Zukunft hat.
Glossar
Verschiedene Fachbegriffe aus der Welt der Finanzen finden Sie in unserem Glossar erklärt.
RECHTLICHER HINWEIS
Diese Veröffentlichung dient unter anderem als Werbemitteilung.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wider, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück.
Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung.
Diese Veröffentlichung unterliegt urheber-, marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung (Übernahme in andere Webseite) der Veröffentlichung ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig.
Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
© 2025 Flossbach von Storch. Alle Rechte vorbehalten.




